 Parasiten- oder auch Schmarotzerbefall bezeichnet den Ressourcenerwerb eines Lebewesens durch die Ausbeutung eines meist größeren Organismus einer anderen Art. Der als Wirt bezeichnete Organismus wird dabei vom Parasit geschädigt, kann aber in der Regel seine Existenz erhalten.
Parasiten- oder auch Schmarotzerbefall bezeichnet den Ressourcenerwerb eines Lebewesens durch die Ausbeutung eines meist größeren Organismus einer anderen Art. Der als Wirt bezeichnete Organismus wird dabei vom Parasit geschädigt, kann aber in der Regel seine Existenz erhalten.
In wenigen anderen Fällen kann, zu einem späteren Zeitpunkt, der Parasitenbefall, zum Tod des Wirtes führen, dann, wenn der Parasit dessen Existenzgrundlagen nachhaltig geschädigt oder völlig vernichtet hat. Parasiten oder Schmarotzer, deren Wirken zum Tode führt, werden als Raubparasiten bezeichnet.Warum ist das Auftreten der Raubparasiten selten zu beobachten? Zu vermuten ist, dass ein der Natur inhärenter Erhaltungsmechanismus für eine ausgleichende Balance zwischen Schädiger und Geschädigtem sorgt, es liegt nicht im Interesse der Natur, ein Ding zu vernichten.
 Ganz anders sieht es bei der „vernunftbegabten Krone der Schöpfung“ dem Menschen aus. Seine Selbsterhaltung versteht sich als ein biologisches Prinzip, das es ihm, wie den anderen Tieren, aufgrund angeborener Verhaltensweisen, usw. ermöglicht, sich als Einzelwesen, Gruppe und Art am Leben zu erhalten. Die Priorität dieses Prinzip ist aber primär nur auf die Zeit bezogen, in der das „Tier“ existiert. Eine Einbeziehung nachfolgenden Lebens ist in diesem biologischen Prinzip der Selbsterhaltung nicht dringlich vorgesehen, da die Selbsterhaltung mit dem Tod des Lebewesens endet.
Ganz anders sieht es bei der „vernunftbegabten Krone der Schöpfung“ dem Menschen aus. Seine Selbsterhaltung versteht sich als ein biologisches Prinzip, das es ihm, wie den anderen Tieren, aufgrund angeborener Verhaltensweisen, usw. ermöglicht, sich als Einzelwesen, Gruppe und Art am Leben zu erhalten. Die Priorität dieses Prinzip ist aber primär nur auf die Zeit bezogen, in der das „Tier“ existiert. Eine Einbeziehung nachfolgenden Lebens ist in diesem biologischen Prinzip der Selbsterhaltung nicht dringlich vorgesehen, da die Selbsterhaltung mit dem Tod des Lebewesens endet.
So ist es auch, zugegeben simpel, zu erklären, warum der Raubparasit Mensch seinen Wirtskörper, seine Existenzgrundlage die Erde, so nachhaltig schädig, so, dass nachfolgende Generationen diesen Wirtskörper nur noch mit gravierenden Einschränkungen werden nützen können. Rücksicht ist im biologischen Prinzip der Selbsterhaltung ein irrationaler Luxus. Letzten Endes fühlt sich das Individuum nur sich selbst, im Hier und Jetzt, verpflichtet.
Als bitteres Fazit bleibt die Feststellung: Die Menschheit wir die Erde erst dann nicht mehr schädigen, wenn es nichts mehr zu schädigen gibt. Die Natur wird sich irgendwann erholen, voraussichtlich wird die menschliche Kreatur dies nicht erleben.
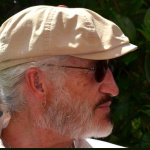 Klaus Schneider im August 2019
Klaus Schneider im August 2019
 Szenario 1: Eine Epidemie in einem europäischen Territorium mit Tausenden von Erkrankten, welche nur durch schnelle Hilfe eine Überlebenschance besitzen. Umliegende Kliniken stoßen schnell an ihre Grenzen, die Versorgung der Erkrankten kann nicht mehr in ausreichendem Umfang erfolgen. Die Verteilung der Erkrankten, über die Peripherie des betroffenen Gebietes hinaus, ist dringend notwendig, es geht um Menschenleben.
Szenario 1: Eine Epidemie in einem europäischen Territorium mit Tausenden von Erkrankten, welche nur durch schnelle Hilfe eine Überlebenschance besitzen. Umliegende Kliniken stoßen schnell an ihre Grenzen, die Versorgung der Erkrankten kann nicht mehr in ausreichendem Umfang erfolgen. Die Verteilung der Erkrankten, über die Peripherie des betroffenen Gebietes hinaus, ist dringend notwendig, es geht um Menschenleben. Auch kein Problem, den Rettungsorganisationen wird, mittels schlichter Rhetorik begründeter Bedenken, die Einreise verweigert. Dass es nicht zu peinlichen Vorfällen auf ihrem Territorium kommt, lassen sie die Transporte schon vor ihren Grenzen mit allerlei perfiden Mitteln sabotieren. Das Sterben der Menschen ist ihnen, gelinde gesagt, scheißegal. Die Gebiete in denen gestorben wird, werden zu Regionen erklärt, in denen kein, sie bindender Rechtsanspruch auf Hilfeleistung, existiert. Solidarität hin, Solidarität her und Menschlichkeit ist kein einklagbares Recht. Eine „Phrase“ die man in Zeiten, in denen sie unangenehmes Engagement fordert, ohne ideelle moralische Probleme, ignorieren darf. Eine Option, welche die christlich- abendländische Kultur seit ihrer Entstehung praktiziert.
Auch kein Problem, den Rettungsorganisationen wird, mittels schlichter Rhetorik begründeter Bedenken, die Einreise verweigert. Dass es nicht zu peinlichen Vorfällen auf ihrem Territorium kommt, lassen sie die Transporte schon vor ihren Grenzen mit allerlei perfiden Mitteln sabotieren. Das Sterben der Menschen ist ihnen, gelinde gesagt, scheißegal. Die Gebiete in denen gestorben wird, werden zu Regionen erklärt, in denen kein, sie bindender Rechtsanspruch auf Hilfeleistung, existiert. Solidarität hin, Solidarität her und Menschlichkeit ist kein einklagbares Recht. Eine „Phrase“ die man in Zeiten, in denen sie unangenehmes Engagement fordert, ohne ideelle moralische Probleme, ignorieren darf. Eine Option, welche die christlich- abendländische Kultur seit ihrer Entstehung praktiziert. Zudem: Der Mensch ist nicht gleich Mensch, Sein Wert ist flexibel, abgestuft nach Nützlichkeit für den, der sich das Recht herausnimmt, dies zu bewerten. Was soll an einem Neger, Nordafrikaner oder Syrer, denn nützlich sein? Sollen sie doch ersaufen, möglichst weit weg aus dem Blickfeld der sensiblen Wahrnehmung europäischer (christlicher) Leitkultur, schließlich hat man ja auch Gefühle.
Zudem: Der Mensch ist nicht gleich Mensch, Sein Wert ist flexibel, abgestuft nach Nützlichkeit für den, der sich das Recht herausnimmt, dies zu bewerten. Was soll an einem Neger, Nordafrikaner oder Syrer, denn nützlich sein? Sollen sie doch ersaufen, möglichst weit weg aus dem Blickfeld der sensiblen Wahrnehmung europäischer (christlicher) Leitkultur, schließlich hat man ja auch Gefühle. Noch ist diese Fiktion innerhalb der Territorien der Demokratien Europas nicht denkbar, noch. Außerhalb dieser Grenzen wird dies Szenario bereits an andersartigen Menschen realisiert. Nur ist zu bedenken, wenn der Damm erst einmal gebrochen ist, gibt es hinter ihm keinen Schutz mehr, für niemanden!
Noch ist diese Fiktion innerhalb der Territorien der Demokratien Europas nicht denkbar, noch. Außerhalb dieser Grenzen wird dies Szenario bereits an andersartigen Menschen realisiert. Nur ist zu bedenken, wenn der Damm erst einmal gebrochen ist, gibt es hinter ihm keinen Schutz mehr, für niemanden! Eine Ideal der Moral und Ethik zeigt der 1875 im Elsass geborene Albert Schweitzer, Theologe, Philosoph und Arzt, auch bekannt als Urwaldarzt von Lambarene, in seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, auf. Ethische Grundsätze, die bis heute nichts von ihrer Verbindlichkeit verloren haben, die keine Religion oder weitere philosophische Denkmodelle zu ihrer Legitimation brauchen, da sie in sich schlüssig und plausibel sind. Eine Korrektur und Adaption an vergängliche Moralitäten schließt sich daher aus. Albert Schweitzers Ethik ist zeitlos, einfach, universell und so eklatant dem menschlichen Wesen entgegengesetzt, dass sie vom real existierenden, menschlichen Charakteristikum, kaum zu realisieren sein wird.
Eine Ideal der Moral und Ethik zeigt der 1875 im Elsass geborene Albert Schweitzer, Theologe, Philosoph und Arzt, auch bekannt als Urwaldarzt von Lambarene, in seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, auf. Ethische Grundsätze, die bis heute nichts von ihrer Verbindlichkeit verloren haben, die keine Religion oder weitere philosophische Denkmodelle zu ihrer Legitimation brauchen, da sie in sich schlüssig und plausibel sind. Eine Korrektur und Adaption an vergängliche Moralitäten schließt sich daher aus. Albert Schweitzers Ethik ist zeitlos, einfach, universell und so eklatant dem menschlichen Wesen entgegengesetzt, dass sie vom real existierenden, menschlichen Charakteristikum, kaum zu realisieren sein wird.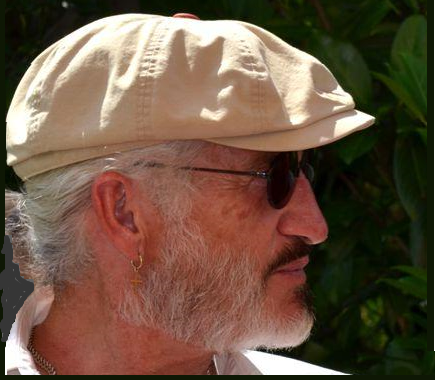
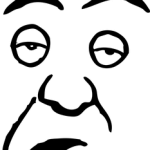 Mit einem emanzipierten Geist und kritischer Distanz zu dem Wesen seiner eigenen Spezies zeigt sich auf den ersten Blick und ist das nicht der objektivste, eine parasitäre, egoistische Kreatur, kaum in der Lage sich selbst zu ertragen, aber von der sie erhaltenden Natur mit dem größten Recht erwartet, dass sie ihn erhält.
Mit einem emanzipierten Geist und kritischer Distanz zu dem Wesen seiner eigenen Spezies zeigt sich auf den ersten Blick und ist das nicht der objektivste, eine parasitäre, egoistische Kreatur, kaum in der Lage sich selbst zu ertragen, aber von der sie erhaltenden Natur mit dem größten Recht erwartet, dass sie ihn erhält.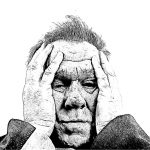 Ein ordentlicher, den Regeln einer Gesellschaft entsprechender Lebensablauf, liegt nicht allein im Willen, im Vermögen, im individuellen Potenzial eines Menschen. Einen weit größerer Anteil ist abhängig vom allgemeinen moralischen Zustand einer Gesellschaft und dem Milieu, in dem der einzelne Mensch sein Leben verbringt und nicht zu vergessen, dem Zufall. Auch dass der Wettbewerb in einer Marktwirtschaft Verlierer hervorbringt, was im Wesen dieses Systems liegt, ist plausibel Keine neuen Erkenntnisse, auch keine, die den Intellekt eines durchschnittlich gebildeten Menschen überfordern würde.
Ein ordentlicher, den Regeln einer Gesellschaft entsprechender Lebensablauf, liegt nicht allein im Willen, im Vermögen, im individuellen Potenzial eines Menschen. Einen weit größerer Anteil ist abhängig vom allgemeinen moralischen Zustand einer Gesellschaft und dem Milieu, in dem der einzelne Mensch sein Leben verbringt und nicht zu vergessen, dem Zufall. Auch dass der Wettbewerb in einer Marktwirtschaft Verlierer hervorbringt, was im Wesen dieses Systems liegt, ist plausibel Keine neuen Erkenntnisse, auch keine, die den Intellekt eines durchschnittlich gebildeten Menschen überfordern würde. Warum aber werden dann Menschen, die nicht den Anstrich der Regel Konformität aufweisen, von einer mit dummer Ignoranz überfressenen Gesellschaft einfach ausgekotzt. Von einer Gesellschaft, die nur ordentliche, optisch attraktive und leistungsfähige Menschen auf der Bühne ihrer Selbstdarstellung duldet. Dort, wo sie besoffen von faulen und vergorenen Idealen, das Hohelied ihrer Dummheit grölen. Immer wieder, denn es ist nicht zu erwarten, dass sie sich besinnen, sie werden bis ans Ende ihrer Tage, den moralisch Sinn eines Lebens nicht begreifen.
Warum aber werden dann Menschen, die nicht den Anstrich der Regel Konformität aufweisen, von einer mit dummer Ignoranz überfressenen Gesellschaft einfach ausgekotzt. Von einer Gesellschaft, die nur ordentliche, optisch attraktive und leistungsfähige Menschen auf der Bühne ihrer Selbstdarstellung duldet. Dort, wo sie besoffen von faulen und vergorenen Idealen, das Hohelied ihrer Dummheit grölen. Immer wieder, denn es ist nicht zu erwarten, dass sie sich besinnen, sie werden bis ans Ende ihrer Tage, den moralisch Sinn eines Lebens nicht begreifen. Die Moral einer Gesellschaft ist nur so gut, wie sie bei den Schwächsten, den Verlieren ankommt. Sie ist nur so gut, wie sie Ehrfurcht vor dem Leben, jedem Leben, hat und dies nicht mit Worten, sondern mit Taten belegt.
Die Moral einer Gesellschaft ist nur so gut, wie sie bei den Schwächsten, den Verlieren ankommt. Sie ist nur so gut, wie sie Ehrfurcht vor dem Leben, jedem Leben, hat und dies nicht mit Worten, sondern mit Taten belegt.